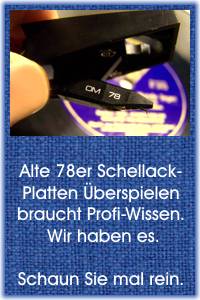Laufwerke für Spieler und Wechsler
aus TELEFUNKEN- Sprecher Heft 51/1970
.
- Anmerkung : Wir sind noch im Jahr 1969 und DUAL ist der unumstrittene Weltmarktführer bei Plattenspielern bzw. Laufwerken. Der DUAL 1219 setzte 1969 wirklich hohe Maßstäbe, daß allen anderen Wettbewerbern weltweit die Tränen in den Augen standen.
.
1. Klassifizierung der Laufwerke
Die Antriebssysteme von Plattenspielern unterscheiden sich im Grundaufbau nur wenig voneinander. In der unteren Preisklasse findet man Geräte für Teenager und Twens mit dem einfachsten Laufwerksaufbau. Chassis und Plattenteller sind zum größten Teil aus Kunststoff gespritzt. Dies hat den Vorteil, daß man im Interesse einer einfachen Montage am Fließband auf Schraubverbindungen verzichten kann.
Das Kunststoffchassis ist so ausgebildet, daß sich die einzelnen Baugruppen auf einfache Weise einknüpfen oder einschnappen lassen. Solche Spritzformen sind zwar sehr teuer, doch lohnt sich der Aufwand bei großen Stückzahlen. Es können erhebliche Montagezeiten eingespart und ein günstiger Marktpreis erzielt werden.
.
Die billigen Kompaktgeräte (bei TELEFUNKEN)
Plattenabspielgeräte dieser Kategorie sind meistens autark, d. h. sie sind mit Netzteil, Verstärker und Lautsprecher ausgestattet. Zum Abspielen von Schallplatten benötigt man also keinerlei Zusatzeinrichtungen. Das Laufwerk ist unkompliziert, und man beschränkt sich im allgemeinen auf die beiden am meisten verbreiteten Plattendrehzahlen von 45 und 33 1/3 U/min. Wie bei vielen Plattenspielern wird auch hier ein Reibradantrieb verwendet. Der Motor ist mit einer sogenannten Stufenachse versehen, an deren Umfang ein gummibelegtes Zwischenrad beim Abspielen einer Schallplatte angelegt wird und den Plattenteller antreibt (Bild 1).
Als Antriebsmotor wird ein sehr preisgünstiger Spaltpolmotor vorgesehen, der durch Gummi- oder Federelemente schwingungsgedämpft am Laufwerkchassis befestigt ist. Diese Dämpfung ist für alle Plattenabspielgeräte wichtig, um das übertragen von Vibrationen auf das Laufwerkchassis, auf den Plattenteller und somit auch auf den Tonarm zu vermeiden (Bild 2). Bei der Schallplattenwiedergabe würden sich sonst solche Vibrationen als Poltergeräusche (Rumpeln) auswirken.
Der TELEFUNKEN "mister hit"
Einen Plattenspieler dieser Art hat der AEG-TELEFUNKEN-Fachbereich Phono- und Magnetbandgeräte unter dem Namen "mister hit" im Programm (Bild 3). Selbst bei diesem einfachen Gerät ist die Auflagekraft des Saphirs - wie bei den teuren Geräten - am Tonarm einstellbar. Als Pick-up wird ein einfaches monophones Kristallsystem verwendet.
Der Endabschalter schaltet die Stromzufuhr für Motor und Verstärker ab. Für die Ein-Aus-Schaltung werden die gleichen Schaltkontakte benutzt. Die mit Geräten dieser einfachen Ausführung erzielte Tonqualität ist "gut" (was bedeutet gut ???). Die erreichbare Drehzahlkonstanz für Tanz- und Unterhaltungsmusik ist mehr als ausreichend.
Die Chassis ohne Verstärker
Bei der nächsten Gruppe von Plattenspielern ist - gegenüber den ganz einfachen Geräten - etwas mehr Aufwand getrieben. Der Plattenteller ist tiefgezogen aus Stahl hergestellt und hat im Interesse eines verbesserten Gleichlaufs ein höheres Trägheitsmoment.
Bei diesem Gerätetyp, der sowohl als Chassis ohne Verstärker als auch mit Mono- oder Stereoverstärker angeboten wird, kann man meist drei oder sogar vier verschiedene Plattendrehzahlen einstellen. Es sind dies die alte Standarddrehzahl 78 U/min, die gebräuchlichen Drehzahlen 45 und 33 1/3 U/min und die seltener benutzte Drehzahl 16 2/3 U/min.
Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale im Antriebssystem liegen in der Mehrgeschwindigkeits-Stufenachse, dem Chassisaufbau auf einer Stahlplatine und dem Einsatz eines etwas stärkeren Motors. Der Tonarm ist mit einer Stereo-Kristallkapsei bestückt und hat eine etwas genauere Vorrichtung zum Einstellen der Auflagekraft erhalten.
Die Mittelklasse (jedenfalls bei TELEFUNKEN)
Diese sogenannten Standardgeräte befriedigen schon "hohe Ansprüche" (Anmerkung : das ist absoluter Unsinn). Klassische Musik - übertragen durch eine gute Stereoanlage - wird zu einem hohen Genuß, selbst wenn in wenigen Punkten noch nicht ganz die HiFi-Bedingungen erfüllt werden, die in den DIN-Spezifikationen 45500 Bl. 3/ 4.66 [2] niedergelegt sind.
Im wesentlichen ist es die zulässige Drehzahltoleranz, die in diesem Normblatt mit +1,5%, -1% angegeben ist und die sich nur durch zusätzlichen Aufwand, z. B. eine Drehzahl-Feinregulierung, einhalten läßt. Ohne solche Maßnahmen treten Abweichungen von 2 bis 3% auf. Wenn man berücksichtigt, daß selbst geübte Musiker die daraus resultierenden Tonhöhenabweichungen noch nicht wahrzunehmen vermögen, so erkennt man, daß die genannten Drehzahlabweichungen gar nicht so kritisch bewertet werden müssen.
Es zeigt sich also, daß schon mit geringem Mehraufwand die HiFi-Forderungen in einer etwas aufgewerteten Geräteklasse des gehobenen Standards zu erfüllen sind.
Die hochwertigen Studiogeräte (bei TELEFUNKEN)
Danach setzt ein Sprung zum hochwertigen Studiogerät ein. Hierbei läßt sich die Solldrehzahl ganz exakt einstellen. Die Gleichlaufschwankungen sind durch einen schweren Plattenteller mit großem Trägheitsmoment auf einen weit unterhalb der Hörschwelle liegenden Wert reduziert, und es werden Magnetkapseln mit Entzerrer-Vorverstärkern verwendet.
Diese Maßnahmen erfordern einen hohen Aufwand und dadurch einen entsprechend hohen Preis, obwohl es sich hierbei nur um reine Plattenspieler handelt. Wechsler werden vorwiegend nach Konzepten der Standard- oder der gehobenen Standardklasse aufgebaut.
Im folgenden sollen einige Einzelprobleme der Schallplattenspieler und -Wechsler behandelt werden:
2. Die Plattendrehzahlen
2.1. Verschiedene Antriebssysteme
Zur Übertragung der verschiedenen Drehzahlen ist - wie schon berichtet - der Reibradantrieb nach Bild 4 weit verbreitet. Dabei können Motor und Zwischenrad sowohl außerhalb als auch innerhalb des Plattentellerbereichs angeordnet sein.
Es sind auch kombinierte Riemen-Reibrad-Antriebe gebräuchlich, bei denen ein Stufen-zwischenrad vom Motor aus über Riemen angetrieben wird (Bild 5). Ferner sind Ausführungen bekannt, bei denen der Riementrieb zwischen Plattenteller und Zwischenrad eingeschaltet ist (Bild 6).
2.2. Drehzahltoleranzen
All diese Antriebe übertragen Drehzahlen auf den Plattenteller, die mit Getriebe- und Motortoleranzen behaftet sind.
Bei der Entwicklung solcher Antriebe wird - nach Berücksichtigung des Schlupfes - aus einer größeren Motorenserie die mittlere Betriebsdrehzahl festgestellt, und danach werden die Antriebsdurchmesser auf den Stufenachsen berechnet. Es lassen sich dabei in der Geräteserie die schon genannten 2 bis 3% Drehzahlabweichung einhalten. Würde man einen teuren Synchronmotor vorsehen, so ließen sich die motorbedingten Toleranzen auffangen.
2.3. Einstellen der Solldrehzahlen
Zum genauen Einstellen der Drehzahl sind im wesentlichen zwei Verfahren bekannt. Bei dem einfachsten Verfahren benutzt man eine konische Stufenscheibe in Verbindung mit einem in der Höhe verschiebbaren Reibrad (Bild 7).
Genauer ist eine einstellbare Wirbelstrombremse, bei der eine am Motor oder am Zwischenrad angebrachte Aluminium- oder Kupferscheibe durch das Magnetfeld eines Dauermagneten abgebremst wird. Der Plattenteller erhält eine etwas höhere Betriebsdrehzahl im Vergleich zur nominellen Drehzahl, und durch radiales Verstellen des Magneten bremst man dann die Drehzahl bis auf den Sollwert ab (Bild 8). Dieses System wendet man bei den HiFi-Spielern an.
2.4. Drehzahlmessung
Zur Anzeige der Solldrehzahl benutzt man eine Stroboskopscheibe (Bild 9), die mit einer aus dem Wechselstromnetz gespeisten Lichtquelle beleuchtet wird. Als Lichtquelle eignen sich am besten normale Leuchtstoffröhren oder Glimmlampen.
Die Teilungen der Stroboskop-scheiben sind einerseits so bemessen, daß bei den Solldrehzahlen ein scheinbar stillstehendes Bild entsteht, wenn die Scheiben mit dem 50Hz Wechsellicht (100 Lichtimpulse je Sekunde = 6.000 je Minute) beleuchtet werden. Andererseits ist die Zahl der Felder so festgelegt, daß ein Wandern der Stroboskopteilung um eine Teilung je Sekunde einer Drehzahlabweichung von 1 % entspricht.
Daraus ergeben sich für die Teilung T = 6000/n bei den einzelnen Geschwindigkeiten:
| 78 U/min | 77 weiße und 77 schwarze Felder, |
| 45 U/min | 133 weiße und 133 schwarze Felder, |
| 33 1/3 U/min | 180 weiße und 180 schwarze Felder. |
Das Abgleichen der Drehzahl wird bei betriebsmäßiger Auflage des Tonarms in den äußeren Rillen ausgeführt.
.
2.5. Gleichlaufprobleme
Sehr viel kritischer als das Einhalten der nominellen Plattendrehzahlen sind periodische Geschwindigkeitsänderungen, die vom Ohr als Tonhöhenschwankungen wahrgenommen werden. Das Maximum der Hörbarkeit liegt bei einer niedrigen Schwankungsfrequenz im Bereich zwischen 1 und 10 Hz, und die Hörschwelle liegt bei einem Wert von etwa ±0,5%.
Die Hörschwelle
Die Hörschwelle ist mit ausgewählter Klaviermusik ermittelt worden, denn Klaviermusik ist in bezug auf Tonhöhenschwankungen am kritischsten, weil Klaviertöne sehr langsam ausschwingen und weil beim Klavier ein natürliches Tremolo, wie es bei anderen Musikinstrumenten anzutreffen ist, fehlt.
Abspielgeräte, bei denen kleinere Werte eingehalten werden, bezeichnet man daher als klavierfest. Bei Schallplatten kann man im allgemeinen unterstellen, daß sie auf Präzisionsgeräten mit sehr geringen Tonhöhenschwankungen hergestellt worden sind, so daß die Hersteller von Plattenspielern und -Wechslern bei der Auslegung ihrer Geräte die Schallplatten-Aufnahmetechnik unberücksichtigt lassen können.
Bei Tonbandgeräten hingegen muß man berücksichtigen, daß sich die Gleichlaufschwankungen vom Aufnahme- und Wiedergabebetrieb addieren [1]. Die für Plattenspieler charakteristischen Störfrequenzen werden hervorgerufen
- durch Motorvibration 100 Hz,
- durch Wellenschlag der Stufenachse am Motor etwa 2800/60 « 47 Hz,
- durch Schlag des Zwischenrades etwa 120/60 « 2 Hz,
- durch Plattenschlag bzw. Tellerschlag etwa 30/60 « 0,5 Hz.
.
Die Bezeichnungen "wow" und "flutter"
Die langsamen Schwankungen bis etwa 10 Hz werden mit "wow" und die schnelleren bis herauf zu etwa 200 Hz mit "flutter" bezeichnet.
Es darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, daß es trotz großer Präzision in der Plattenschneidtechnik gelegentlich vorkommt, daß Schallplatten mit nicht ganz zentrischem oder zu weitem Mittelloch auf den Markt gelangen. Solche Platten verursachen natürlich auch auf den besten Abspielgeräten Tonhöhenschwankungen.
2.6. Messen von Tonhöhenschwankungen
Das wertmäßige Erfassen von Tonhöhenschwankungen ist weitaus komplizierter als das Ermitteln der Plattendrehzahlen. Man benötigt hierfür ein besonderes Prüfgerät, den Tonhöhenschwankungsmesser, eine Frequenzschallplatte mit einer schwankungsfreien 3150-Hz-Auf-zeichnung und möglichst noch ein Registriergerät zur Analyse der Schwankungsfrequenz.
Der Tonhöhenschwankungsmesser verfügt über ein Filternetzwerk, das den Hörbarkeitsverlauf des Ohres berücksichtigt. Meßmethode und Frequenzverlauf des Filters sind im DIN-Blatt 45507/ 10.68 [3] festgelegt (Bild 10).
3. Bedienungsautomatik
3.1. Automatisches Aufsetzen des Tonarms bei Plattenspielern
Das Aufsetzen des Tonarms auf die Platte erfordert etwas Übung und vor allem eine ruhige Hand. Eine unsanfte Aufsetzbewegung kann leicht zum Beschädigen der Schallplatte führen. Um dem Bedienenden diese Sorgfaltspflicht abzunehmen, sind Plattenspieler mit Aufsetzhilfen konstruiert worden. Bei der einfachsten Ausführung bewegt man den Tonarm von Hand nach innen bis zur Einlaufrille der aufgelegten Schallplatte und betätigt dann den Lifthebel, der den Tonarm unter Beibehalten seiner radialen Position feinfühlig auf die Platte senkt.
Zum leichten Auffinden der Tonarmstellungen für die verschiedenen Plattengrößen dient ein Rastblech, in das den Plattendurchmessern entsprechende Vertiefungen eingeprägt sind, so daß man beim Einschwenken des Tonarms den richtigen Einsatzpunkt spürt (Bild 11).
Soll eine Schallplatte nicht bis zum Ende abgespielt werden, so kann der Tonarm mit dem Lifthebel genauso schonend von der Platte abgehoben werden.
Während diese Aufsetzhilfe noch voll handbedienbar ist, wird beim automatischen Plattenspieler sowohl das Einschwenken als auch das Aufsetzen automatisch ausgeführt. Dabei kann der Plattendurchmesser entweder mit Hilfe einer Vorwahleinrichtung vorgewählt oder bei einer weiteren Automatisierung durch einen Fühlmechanismus automatisch eingestellt werden.
3.2. Plattenwechsler
Die im vorigen Abschnitt geschilderte Aufsetzvorrichtung mit automatischer Wahl des Tonarm-Aufsetzpunktes kann als Vorstufe zu den selbsttätig arbeitenden Mehrplattenspielern angesehen werden. In den Plattenwechslern findet man die gleiche Mechanik wieder. Hinzu kommt - mit dem automatischen Einschwenken und Aufsetzen gekoppelt - das Abwerfen einer Platte vom Plattenstapel, der aus acht bis zehn Platten bestehen kann.
Ein Plattenwechsler führt im allgemeinen folgende Bewegungsabläufe automatisch aus:
.
- a) Heranführen des Tonarms von einer außerhalb der Platte liegenden Rastposition bis zur Einlaufrille,
- b) Aufsetzen des Tonarms,
- c) Freigeben des Tonarms zum Abspielen der Platte,
- d) Abheben des Tonarms von der Platte am Ende, eingeleitet durch die Auslaufrille der Platte,
- e) Zurückschwenken des Tonarms in die Ausgangsposition,
- f) Abwurf einer neuen Platte,
- g) Wiederholen des Zyklus a) bis f).
.
Und hier kommt völliger Unsinn - die Repeat Funktion
Die Funktionen wiederholen sich so lange, bis alle Platten abgespielt sind. Die danach noch automatisch durchgeführten Bewegungsvorgänge sind bei den einzelnen Wechslersystemen recht unterschiedlich.
Es gibt Plattenwechsler, die wiederholen die letzte Platte so lange, bis das Gerät von Hand ausgeschaltet wird. Andere wieder schalten ab und lassen den Tonarm auf der Platte aufliegen. Die am vollkommensten automatisierten Wechsler schwenken den Tonarm bis auf die Auflagestütze zurück, senken ihn ab und schalten erst dann das Gerät aus.
Der mechanische Aufwand einer Automatik
Zur Ausführung aller kinematischen Funktionen ist ein komplizierter Steuermechanismus notwendig, der seine Betätigungsenergie im wesentlichen vom Antriebsmotor des Plattentellers erhält. Der Steuermechanismus ist daher nur im eingeschalteten Zustand des Wechslers wirksam und dann auch nur während des Wechselvorgangs.
Es ist nicht einfach, die komplizierten Bewegungsvorgänge leicht verständlich an Hand von Skizzen zu beschreiben. Deshalb soll hier nur auf den besonders interessanten Vorgang des Platten-wechselns eingegangen werden.
Im Bild 12 ist ein Ausschnitt aus der Mechanik eines Wechslers gezeigt. Das Kupplungsteil wird beim Wechselvorgang mit einem Schaltnocken am Plattenteller in Eingriff gebracht. Dadurch dreht sich die Steuerscheibe in Pfeilrichtung.
Der fest an der Steuerscheibe befestigte Schubstift bewegt den Schieber in Richtung A, so daß dessen Auflaufschräge gegen den Stift am Betätigungshebel drückt und somit den Plattenstoßer der Wechselachse in Pfeilrichtung bewegt. Durch diese Bewegung wird der Platten-stoßer um seine Achse geschwenkt (Bild 13), wobei sich die untere Schallplatte des Stapels nach rechts verschiebt und auf den Plattenteller fällt.
.
Der Plattenniederhalter
Da die Schallplatten bei dieser Ausführung der Wechselachse nur einseitig gehalten werden, ist hier ein Plattenniederhalter erforderlich, der von oben auf den Plattenstapel drückt. Der Niederhalter wird auch zum Endabschalten des Wechslers benutzt. Wenn die letzte Platte gefallen ist, macht er eine Abwärtsbewegung in Richtung auf den Plattenteller und bereitet dadurch die Endabschaltung vor.
Bei einem anderen viel angewandten Wechselachsensystem ist ein Niederhalter nicht erforderlich (Bild 14). Der Plattenstapel wird von drei symmetrisch am Umfang der Wechselachse verteilten Spreizhebeln getragen. Während des Wechselvorgangs dreht sich eine Kurvenscheibe und hebt einen Nocken. Der Nocken gleitet auf einer Rolle hoch und betätigt eine Hubstange innerhalb der Wechselachse in Pfeilrichtung. Dabei lösen zwei Betätigungskegel den Plattenabwurf aus.
Der obere Kegel sorgt dafür, daß der Plattenstapel mit Ausnahme der unteren Platte durch drei symmetrisch angeordnete Klemmstücke festgehalten wird, während der untere Kegel die drei Spreizhebel in das Rohr der Wechselachse einschwenken läßt. Damit fällt die untere Platte auf den Plattenteller.
Um eine hohe Funktionssicherheit bei Schallplattenwechslern zu erzielen, sind eine sehr präzise Einzelteilfertigung und eine sorgfältige Montage Vorbedingung. Langjährige Erfahrungen im Bau von Spielern und Wechslern kommen hierbei den Erzeugnissen zugute.
H.-J. Frauendorf und G. Freiter (Nachdruck aus Techn. Mitteilungen
aus TELEFUNKEN- Sprecher Heft 51/1970
.
Bilder :
Bild 2. Übertragung von Vibrationen als Ursache von Rumpelstörungen
Bild 3 ???????. Das preisgünstige Phonogerät "mister hit" mit Verstärker und Lautsprecher
Bild 3. Das preisgünstige Phonogerät mister hit mit Verstärker und Lautsprecher
Bild 4. Reibradantrieb für vier Geschwindigkeiten
Bild 5. Kombinierter Riemen-Reibrad-Antrieb; Anordnung des Riemens zwischen Motor und Stufenrad
Bild 6. Riemen-Reibrad-Antrieb; hier wird der Plattenteller von einem Riemen angetrieben
Bild 7. Konische Stufenachse mit einstellbarem Zwischenrad zur Drehzahl-Feinregulierung
Bild 8. Drehzahl-Feinregulierung mit Hilfe einer Wirbelstrombremse
Bild 9. Stroboskopscheibe zum Ermitteln oder Einstellen der nominellen Plattentellerdrehzahlen
Bild 10. Bewertungskurve für Tonhöhen-Schwankungen nach DIN 45507
Bild 11. Aufsetzhilfe für den Tonarm bei Plattenspielern
Bild 12. Auslösemechanismus für den Plattenwechsel
Bild 13. Ausführungsform einer Wechselachse; bei diesem Prinzip ist ein Plattenniederhalter erforderlich
Bild 14. Wechselachse mit Spreizmechanismus; ein Niederhalter für Platten ist nicht erforderlich
AEG-TELEFUNKEN 59 (1969) Heft 5)
Schrifttum
[1] H.-G. Frerichs: Mechanische und elektrische Forderungen an Heimtonbandgeräte. Techn. Mitteilungen AEG-TELEFUNKEN 59 (1969) 5, S. 294 bis 296, 1 B, 1 Qu.
[2] DIN 45500 Bl. 3/4.66: Heimstudio-Technik (HiFi); Mindestanforderungen an Schallplatten-Abspielgeräte.
[3] DIN 45507/10.68: Meßgerät für Frequenzschwankungen bei Schallspeichergeräten.
TELEFUNKEN- Sprecher Heft 51/1970
.