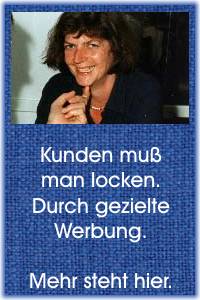Service an Tonabnehmer und Nadelträger (Wissen von 1972)
aus TELEFUNKEN- Sprecher Heft 58/1972
An Anfang einer Schallplattenwiedergabeanlage steht das "Phonogerät" (Anmerkung : wir nennen es den Plattenspieler) und hier wieder an erster Stelle das Tonabnehmersystem. Mit seiner Abtastnadel folgt es den Rillenauslenkungen der Schallplatte und verwandelt die mechanischen Bewegungen in verhältnisgleiche elektrische Spannungen. Von der Abtastfähigkeit dieses »elektromechanischen Wandlers« hängt die Qualität der Wiedergabe in hohem Maße ab. Was bei der Abtastung unterlassen oder verändert wird, können die besten nachgeschalteten Verstärker und Lautsprecher nicht mehr verbessern.
Hauptsächlich zwei Wandlerarten
In der Praxis werden hauptsächlich zwei Wandlerarten angewendet. In Phono-geräten der unteren und mittleren Preisklasse benutzt man fast ausschließlich Piezo-Tonabnehmer, auch Kristallkapseln genannt. Die Wandlerelemente bestehen hier aus dünnen blättchenförmigen Seignettesalz-Kristallen, die beim Verbiegen eine elektrische Spannung bilden.
Ebenfalls zu den Piezo-Wandlern gehören die sogenannten Keramikkapseln, deren Wandlerelemente meist aus Bariumtitanat bestehen. Wegen ihrer höheren Un-empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und Wärme werden Keramiksysteme vorzugsweise in Exportgeräten eingesetzt.
In HiFi-Geräten findet man fast ausschließlich magnetische Tonabnehmer. Ihre Arbeitsweise beruht auf dem Prinzip der magnetischen Induktion: Der von den Nadelauslenkungen veränderte magnetische Fluß schneidet die Windungen einer Spule und induziert in ihr elektrische Spannungen. Wegen der größeren Nadelnachgiebigkeit, Compliance genannt, werden magnetische Tonabnehmer den HiFi-Forderungen nach kleiner Auflagekraft und Spursicherheit bei hohen Aussteuerungen über den gesamten Tonfrequenzbereich gerecht.
.
Größtmögliche Plattenschonung
Neben den Ansprüchen an die Wiedergabequalität besteht an das Abtastsystem die Forderung nach größtmöglicher Plattenschonung. Selbst nach vielmaligem Abspielen einer Schallplatte dürfen sich noch keine Abnutzungserscheinungen zeigen. Das ist allerdings nur dann gewährleistet, wenn sich das System und die Abtastnadel in einwandfreiem Zustand befinden.
Eine Abtastnadel, die Abschlifferscheinungen zeigt, verschlechtert nicht nur die Wiedergabe sondern wird auch die der Modulation entsprechenden Rillenflanken insbesondere bei höheren Frequenzen und größeren Amplituden für immer deformieren.
Welche statischen Kräfte während des Abspielvorganges auf die Abtastnadel einwirken, ist in Bild 1 verdeutlicht. Wie zu ersehen, berührt die kugelförmige Spitze der Nadel die Flanken der Rille etwa in der Mitte. Bei einer angenommenen Auflagekraft P = 3 p (Pond) wirken entsprechend dem Parallelogramm der Kräfte an den Berührungsstellen
.
Formel 1
.
Ein paar Beispiel für die Werte
Da die Schallplatte aus elastischem Kunststoff besteht, berührt die Nadelkuppe die Rillenflanke nicht punktartig sondern entsprechend dem Verrundungsradius der Kuppe kreisförmig.
Nimmt man an, daß sich bei einer Auflagekraft von 3 p und einem Nadelverrundungsradius von 15um Berührungsflächen von ca. 6um Durchmesser ergeben, so kann man den spezifischen Druck, bezogen auf den cm², wie folgt ermitteln:
Die Berührungsfläche ergibt:
Formel 2
.
Dividiert man den Auflagedruck durch die Berührungsfläche, so ergibt sich der spezifische Druck.
Formel 3
.
Die Vorstellung der Größen-Verhältnisse ......
Vergegenwärtigt man sich weiterhin, daß die Rille einer 30cm-Schallplatte etwa 600 Meter lang ist, der Durchmesser der Nadelberührungsfläche hingegen nur etwa 6um (6 millionste! Meter) beträgt - was einem Verhältnis von rund 1 : 100000000 entspricht -, so kann man sich gut vorstellen, daß die harte Nadel von der relativ weichen Platte nach und nach abgeschliffen wird.
Staub auf der Schallplatte beeinträchtigt ebenfalls die Wiedergabequalität und führt zu einem schnelleren Verschleiß von Nadel und Platte.
Der Einfluß der Staubablagerungen
Die organischen Bestandteile des Staubes setzen sich an der Nadel fest und bilden dann, wie Bild 2 zeigt, den sogenannten Staubbart. Die Folge sind Verzerrungserscheinungen durch Behinderung der Nadelführung und Vergrößerung der Nadelmasse.
Die anorganischen Bestandteile des Staubes (feiner Sand, Metallstaub u. ä.) setzen sich auf den Flanken der Rille fest und bilden die Ursache von Knister- und Knackgeräuschen beim Abspielen der Platte.
Darüber hinaus schmirgelt der Staub mehr oder minder die Nadelkuppe ab. Unterstützt wird dieser Vorgang noch von den Abschliffresten der Nadel selbst, die sich ebenfalls auf die Rillenwände ablagern.
Fallenlassen des Tonarms
Belastet man die Nadelkuppe schlagartig, z. B. durch Fallenlassen des Tonarms auf die Schallplatte, so kann, wie in Bild 3 zu sehen, ein Teil der spröd-harten Nadelkuppe absplittern.
Spielt man eine Schallplatte mit einer derart beschädigten Nadel ab, so wird je nach Lage der Bruchstelle die Modulation der Rille in Form von feinen Spänen ausgefräst.
Genaue Angaben über die Lebensdauer von Saphir- und Diamantnadel lassen sich, ohne den Zustand der abgespielten Schallplatten bzw. die Größe der Auflagekraft des Tonabnehmersystems zu kennen, nicht machen.
.
Verschleiß und Lebensdauer (Wissen von 1972)
Grundsätzlich gilt: Saphirnadeln sollten spätestens nach 80 Betriebsstunden ausgetauscht werden. Die Diamantnadeln erreichen wegen ihrer größeren Härte zwar eine 5 bis 10fach höhere Lebensdauer, doch sollte der Benutzer im Interesse seiner wertvollen Schallplatten sich der kleinen Mühe unterziehen, seine Diamantnadel mindestens halbjährlich vom Fachhändler überprüfen lassen.
Nur so können Verschleißerscheinungen rechtzeitig erkannt und empfindliche Schäden vermieden werden. Außerdem besteht die Gefahr, daß sich der Hörer bei langsam zunehmender Nadelabnutzung an die damit verbundene Klangveränderung gewöhnt und auf diese Weise seinen Schallplatten ungewollt ernsthafte Schäden zufügt.
- Anmerkung : Über den wirklichen Verschleiß des Abtastdiamanten gibt es eine Promotions-Arbeit von Karl Günter Schwartz aus 1069 sowie eine fachlich gnadenlos qualifizierte Labor-Studie aus den Polydor Labors aus 1979.
Saphirnadeln mit verschiedenen Abnutzungsgraden sind in Bild 4 dargestellt. Bild 4a zeigt eine Nadel nach 75 Betriebsstunden, während die Bilder 4b und 4c Betriebszeiten von 100 und 150 Stunden entsprechen. Die linke Ansicht zeigt die Nadel in der Rille, die rechte jeweils die Schleifflächen der Nadel.
Die Nadel überprüfen ist nicht einfach
Bei dem in Bild 4a erkennbaren Abschliff ist ein Nadelwechsel bereits zu empfehlen. Im Fall 4b und 4c sind Plattenschäden unvermeidbar.
Zum Beurteilen der Nadelabnutzung eignet sich am besten ein Mikroskop mit 100- bis 200-facher Vergrößerung. Bei Vergrößerungen unter 100fach wird der Abschliff meist zu spät, daß heißt im fortgeschrittenen Stadium erkannt. Bei Vergrößerungen über 200-fach fehlt der schnelle Überblick; die Nadelkuppe läßt sich dann schwer auffinden.
Die Qualität einer Nadel hängt in hohem Maße davon ab, daß bei der Herstellung die genaue Achsrichtung der Rohkristalle beachtet wird, d. h. sie muß aus den härtesten Zonen eines Diamant-Oktaeders geschliffen sein. Außerdem ist die präzise Form der Spitzenverrundung und deren einwandfreie Politur von ausschlaggebender Bedeutung.
Im Interesse des Kunden sollten nur TELEFUNKEN-Nadelträger in der Originalverpackung verwendet werden. Minderwertige Imitationen, die auf dem Markt angeboten werden, ergeben nicht nur eine merkliche Klangverschlechterung, sondern führen auch zu erhöhtem Plattenverschleiß.
Über den Service bei Störungen am Abtastsystem und an der Nadel orientiert die nachstehende Tabelle I. In den Tabellen II und III sind die TELEFUNKEN-Abtastsysteme und Nadelträger für Ersatzbestückung aufgeführt.
W. Loos aus TELEFUNKEN- Sprecher Heft 58/1972
.
Bilder
Bild 1. Statische Kräfte in der Rille
Bild 2. Staubansammlung (Staubbart) an der Abtastnadel
Bild 3. Abtastnadel mit abgesplitterter Kuppe
Bild 4. a-c Abschliff-Flächen an Abtastnadeln nach verschiedenen Betriebszeiten
TELEFUNKEN- Sprecher Heft 58/1972
Hier folgen ein paar Tabellen
Die Darstellung der Original-Tabellen ist nicht ganz so einfach, sie sind zu breit und zu voll.
Tabelle I. Fehlerursachen an Tonabnehmersystemen und Nadelträgern
Indikator: Stereo-Testschallplatte TST 72 363; Abhörkontrolle über Wiedergabeeinrichtung; Röhrchen-Federwaage 10 p (0,098 N); Mikroskop-Vergrößerung möglichst 100 ... 200-fach
.